This page is not available in English

Vorgänger der „Tupperware“:
Das Kubus Geschirr von Wilhelm Wagenfeld (weiterlesen ...)

Die Schiebetüren des Geschirrschranks in der Frankfurter Küche(weiterlesen ...)
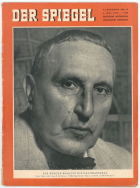
DER SPIEGEL, Ausgabe 19/1955 vom 4. Mai 1955(weiterlesen ...)